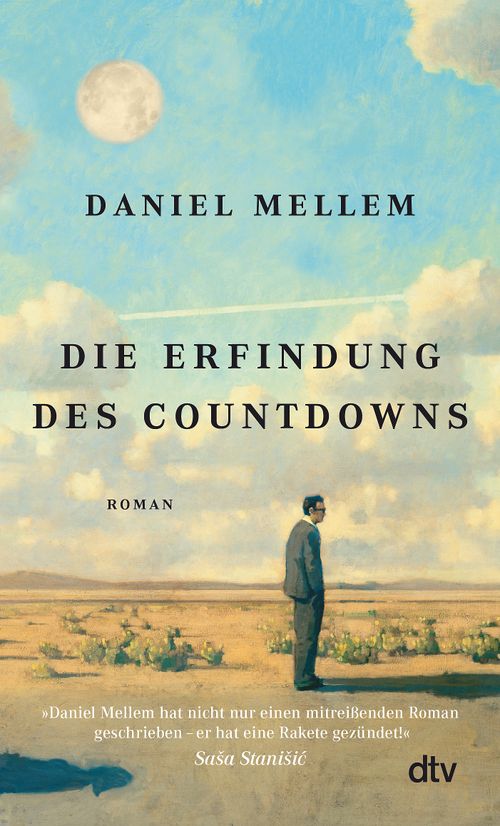Von Fakt und Fiktion in meinem Roman über Hermann Oberth – ein Essay von Daniel Mellem
In seinem Debütroman ›Die Erfindung des Countdowns‹ widmet sich der Schriftsteller und promovierte Physiker Daniel Mellem dem Raketenpionier Hermann Oberth (1894-1989). Doch wo hören die Fakten auf und wo beginnt die Fiktion? Ein Essay und Einblick in die Werkstatt des Romanschreibens.
Als ich im August 2020 am Leseclubfestival teilnahm, war mein Roman ›Die Erfindung des Countdowns‹ über den Raketenpionier Hermann Oberth noch nicht erschienen. Es war meine erste Veranstaltung zum Buch. Das erste Mal würde ich nun öffentlich über meinen Text sprechen. Ich war sehr aufgeregt. Alle waren freundlich und neugierig, schnell entstand ein Gespräch über das Verhältnis von Fakt und Fiktion und die historische Akkuratesse in meinem Roman: Ob es wirklich stimme, dass Fritz Lang den Countdown erfunden habe. Ob ich selbst in Hermann Oberths Heimat Siebenbürgen gewesen sei. Wieviel ich über Oberths Frau Mathilde wisse.
Eine Teilnehmerin gestand, gewisse Vorbehalte gegenüber biographischen Romanen zu hegen. Sicherlich sei alles gründlich recherchiert und sauber zusammengetragen, doch welche Funktion erfülle so ein Text eigentlich? Im Grunde sei das doch kein Roman, kein „Romanroman“ zumindest – wozu also das Ganze? Warum nicht gleich ein Sachbuch? Diese Fragen berühren die Grundfesten eines solchen Textes und auch ich habe sie mir beim Schreiben immer wieder gestellt. Sie lassen sich nicht in wenigen Sätzen beantworten.
Die Diskussion um die Einordnung von scheinbar authentischen Texten ist jüngst wieder entflammt. Können Autofiktionen Romane sein? Oder sind das doch eher Erlebnisberichte? Auch hier liegt ein Reiz für die Leser*in im anscheinend (oder scheinbar?) faktisch Beglaubigten. Zweifelsohne sind diese Texte trotzdem (oder gerade deshalb?) Literatur. Was nun aber, wenn die Autor*in nicht über sich selbst schreibt? Wenn sie von einer anderen Person erzählt, die es tatsächlich gegeben hat? Wo ist da der Übergang von der Literatur zum Sachtext?
Eine reizvolle Spannung ergibt sich für mich aus einem vermeintlichen Paradoxon: Eine Verengung der Perspektive weitet den Blick auf die Welt. Erst durch die Augen einer literarischen Figur werden eine bestimmte Zeit und ihre Umstände erlebbar. Erst so lässt sich mitfühlen und mitleiden in einer fiktionalen Wirklichkeit, die nicht identisch ist mit der historischen Wirklichkeit, die aber eine, sagen wir, Möglichkeit von ihr darstellt. Erst in ihr kann ein Verstehen einsetzen, werden Widersprüche erfahrbar – im Fall von ›Die Erfindung des Countdowns‹ das Leben von Hermann Oberth. Eines voller Sehnsüchte und Verfehlungen, ausgehend vom siebenbürgischen Jungen, der Jules Vernes liest, bis hin zum alten Mann auf der Zuschauertribüne in Cape Canaveral, der die Mondrakete starten sieht – die Erfüllung seiner Utopie, belastet mit all der Schuld und Enttäuschung eines langen Lebens.
Was unterscheidet den historischen Hermann Oberth von der Romanfigur?
Für den Roman gilt: Die Figur ist nicht deckungsgleich mit der historischen Person selbst – sie ist eine Idee der Autor*in von ihr. Die Autor*in ist es, die aus den losen Fakten die Erzählung formt. „Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält“, sagt Max Frisch. Im biographischen Roman unternimmt die Autor*in das Wagnis, dies für einen anderen Menschen zu tun. Das ist gleichzeitig auch Anmaßung: Die Autor*in nimmt sich ein fremdes Leben, spielt damit herum, erfindet, und schafft so das, was sich Fiktion nennt – in der Hoffnung, dass die Erfindung die Anmaßung zumindest teilweise (wenn auch nie ganz) rechtfertigen möge.
Wo aber fängt das Erfinden an? Wo hört der Fakt auf und wo beginnt Fiktion? ›Die Erfindung des Countdowns‹ erzählt siebzig Jahre eines Lebens auf knapp dreihundert Seiten. Da kann und soll nicht alles berichtet und nicht jede Chronologie eingehalten werden. Dramaturgische Verdichtung ist unumgänglich, erst durch sie manifestiert sich die Erzählung.
Aufgabe der Autor*in ist, aus den Fakten das zu destillieren, was sie für die Essenz hält. Die kann ähnlich sein oder auch ganz anders als das, was die historische Person von sich selbst gehalten hat. Denn auch sie folgt nur der eigenen Narration, die sich laufend ändern und Widersprüche offenbaren kann. Der historische Oberth sprach davon, dass es Vernes Romane waren, die ihn zur Rakete inspiriert hätten, in den Zwanzigern schrieb er in Briefen, er habe bloß den Wunsch, „einen Flug in die Planetenräume zu oder noch lieber auf fremde Weltenkörper zu fliegen.“ Im Alter wiederum erzählte Oberth, die Raumfahrt sei nur ein Umweg gewesen, den Deutschen und damit auch den Nationalsozialisten und Hitler die Waffe zu bringen – unterschiedliche Geschichten, die dieser Mensch zu verschiedenen Zeitpunkten von sich selbst erzählt hat.
Was nun aber für die Autor*in die Essenz bedeutet, muss sie immer wieder neu mit sich selbst verhandeln, in jedem Kapitel, auf jeder Seite, in jedem Satz, mit jedem Wort. Im Folgenden möchte ich Beispiele geben.
Der historische Oberth begann 1913 ein Medizinstudium in München. Im Jahr darauf brach der Erste Weltkrieg aus, Oberth kehrte in seine Heimat zurück und ging als Kriegsfreiwilliger an die Front. Im Roman dagegen kommt Hermann erst nach Deutschland, als der Krieg vorüber ist und er sich entschieden hat, Physik zu studieren.
Warum habe ich das Medizinstudium ausgelassen? Die Figur – die literarische genauso wie die historische – steht unter dem Eindruck eines dominanten Vaters. Oberths Vater war selbst Arzt, ein Pflichtbesessener, von dem erzählt wird, er habe 18 Stunden täglich gearbeitet und sich einer Legende zufolge sogar selbst den Blinddarm entnommen. Der Vater wünscht von seinem Sohn Hermann, dass auch er Arzt wird. So studiert der historische Oberth vor Kriegsausbruch einige Monate in München Medizin und versorgt später während des Krieges als Hilfsarzt die Verwundeten im Schäßburger Spital – wo sein Vater Direktor ist. Es ist die große Herausforderung von Oberth, sich von diesem Vater und dessen Erwartungen zu emanzipieren, und seinen eigenen Weg zu gehen. Im Roman geschieht dies an dem Ort, der stellvertretend für den Konflikt zwischen Vater und Sohn steht: dem Spital. Erst nachdem Oberth seinem Vater dort eröffnet hat, dass er nicht Arzt werden will, sondern Physiker, kann er in eine für ihn neue Welt aufbrechen. Der Gang nach Deutschland für ein Physikstudium steht in diesem Leben also auch metaphorisch. Und so entschied sich der Autor – ich – Hermann im Roman nie in München studieren zu lassen. Er bleibt so lange in der Heimat, bis er sein Schicksal in die eigenen Hände nimmt.
Ein anderer dramaturgischer Eingriff: Im Roman begegnet Hermann dem Studenten Wernher von Braun, als er an einer Werberakete für den Film Frau im Mond von Fritz Lang arbeitet. Von Braun ist jung und ehrgeizig, weniger Wissenschaftler als Hermann, eher Manager. Er hilft Hermann beim Bau der Rakete für die Filmpremiere. Doch wo trafen sich Hermann Oberth und Wernher von Braun tatsächlich? Der historische Oberth lernte von Braun erst einige Monate nach der Filmpremiere kennen, vermutlich auf dem Raketenflugplatz in Tegel, wo sie die Kegeldüse testeten. Ihr beider Leben werden sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Der historische Oberth wird in Berlin scheitern und geschlagen nach Siebenbürgen zurückkehren. Von Braun dagegen steht erst am Anfang eines Weges, auf dem er schon bald zur Reichswehr stoßen und dort Karriere machen wird. Ihre Schicksale sind eng miteinander verknüpft, die Verläufe aber diametral. Hermann überschätzt sich, verzettelt sich, hat Pech und Unfälle, wird nicht gehört. Von Braun ist engagiert, weiß Menschen für sich einzunehmen, Kontakte zu nutzen, behält den Überblick und kann sich in Szene setzen. Im Roman bot die Filmepisode Gelegenheit, genau das szenisch zu kontrastieren und zu zeigen, was für Hermann den Fall, für von Braun aber den Aufstieg bedeutet.
Literatur weiß nicht, Literatur zeigt.
Zuweilen muss die Autor*in beim Schreiben feststellen, dass das, was sie destilliert zu haben meint, später große Kopfschmerzen bereitet. Zu Beginn der Arbeit am Roman verkörperte Hermann Oberth für mich den Idealtypus eines Wissenschaftlers und ich entwarf meine Figur als einen naiven, sympathischen Nerd, ganz seinem Traum von der Raumfahrt verschrieben. Doch je mehr ich las und recherchierte, desto mehr verstand ich, wie überzeugt der historische Oberth mit den Nationalsozialisten paktiert hatte. So war auch seine Mitgliedschaft in der NPD in den sechziger Jahren keine Altersverirrung gewesen, sie stand stellvertretend für nationalistische und rassistische Ressentiments. Was für ein Widerspruch! Ein Mensch, der von einer utopischen Zukunft träumt und gleichzeitig verhaftet ist in der menschenverachtenden Ideologie seiner Gegenwart.
Ich versuchte in den Widerspruch hineinzugehen und die politischen Verstrickungen des historischen Oberth zu verstehen. Er hatte die Schrecken des Ersten Weltkriegs an der Front und später im Spital selbst erlebt, er hatte damals seinen Bruder verloren. Da lag es für ihn nahe, die Rakete als eine Waffe zu denken, so schrecklich, dass sie künftige Kriege verhindern könnte. Auch lebte er zwischen den Welten, in Rumänien war er Deutscher und in Deutschland Rumäne. Er rang mit seiner nationalen Identität, wollte dazugehören, wollte eine Waffe für Deutschland bauen. Dass Oberth damit aber ein menschenverachtendes Regime unterstützte und das nicht nur nicht hinterfragte, sondern sogar mit dem Nationalsozialismus sympathisierte, das wollte mir nicht in den Kopf.
Eine Weile ließ mich das verzweifeln – und am Ende half die Literatur. Denn (anders als ich das aus meiner Tätigkeit als Physiker kenne) muss die Literatur keine Erklärungsmodelle anbieten. Sie kann in Widersprüche hineingehen, ohne sie aufzulösen. Sie eröffnet Perspektiven, die uns unvertraut sind, stellt exemplarisch Fragen, ohne sie zu beantworten. Literatur weiß nicht, Literatur zeigt. Das Verständnis setzt erst danach ein. Oder auch nicht.
Es gibt im Roman eine Szene in Peenemünde, als Hermann das Patent eines Polen vorgelegt wird, der zum Tode verurteilt ist und sich auf diese Weise offenbar retten will. Hermann prüft das Patent, winkt es durch, der Pole muss trotzdem sterben. Der historische Oberth erwähnt diese Begebenheit in einem Interview, er ist da schon 93 Jahre alt.[1] Lange rang ich mit mir, ob ich diese Episode im Roman aufnehmen sollte. Viele Fragen waren für mich unbeantwortet. Hatte Oberth das Patent aus Mitleid gebilligt? Hatte er es kühl geprüft? Warum erinnerte er sich im hohen Alter noch daran? Spürte er Schuld? Ich entschied mich schließlich dafür, die Begebenheit aufzunehmen, ohne eine Haltung der Figur dazu zu erfinden, Hermann nicht grübeln oder mit sich ringen zu lassen, sondern offen zu halten, was er wirklich dachte. Die Szene zeigt, dass Hermann im Roman unmittelbar mit dem Schrecken konfrontiert war, zu dem er selbst beitrug – und sie stellt die Frage nach der moralischen Verantwortung eines Wissenschaftlers. Gerade durch die Leerstelle, die hier gelassen wird.
Es sind auch diese Leerstellen, die für mich den Reiz eines literarischen Textes über eine historische Figur ausmachen. Die Widersprüche offenzulegen, Brüche zu zeigen und so implizit Fragen zu stellen, die die literarische Figur von der historischen Person lösen und ihr eine exemplarische Dimension verleihen. Mit der Literatur kann eine Suche nach Antworten beginnen – für den Menschen an sich. Wie die Fragen aber für den speziellen Fall des historischen Hermann Oberth faktisch zu beantworten sind, das müssen Historiker*innen bewerten, Quellen prüfen, Aussagen einordnen – in einem wissenschaftlichen Aufsatz oder vielleicht auch in einem Sachbuch.
Dies aber ist ein Roman.
© Daniel Mellem, 2020
Wir danken Daniel Mellem für diesen exklusiven Beitrag für 26 Zeichen, den Blog der dtv Verlagsgesellschaft.
Zum Autor: Daniel Mellem, geboren 1987, lebt in Hamburg. Sein Studium der Physik schloss er mit einer Promotion ab, bevor er sich am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig der Arbeit an seinem ersten Roman widmete. Sein Debüt ›Die Erfindung des Countdowns‹ (2020, dtv) wurde mit dem Retzhof-Preis für junge Literatur und dem Hamburger Literaturförderpreis ausgezeichnet und war für den Klaus-Michael-Kühne-Preis nominiert.
[1] Quelle