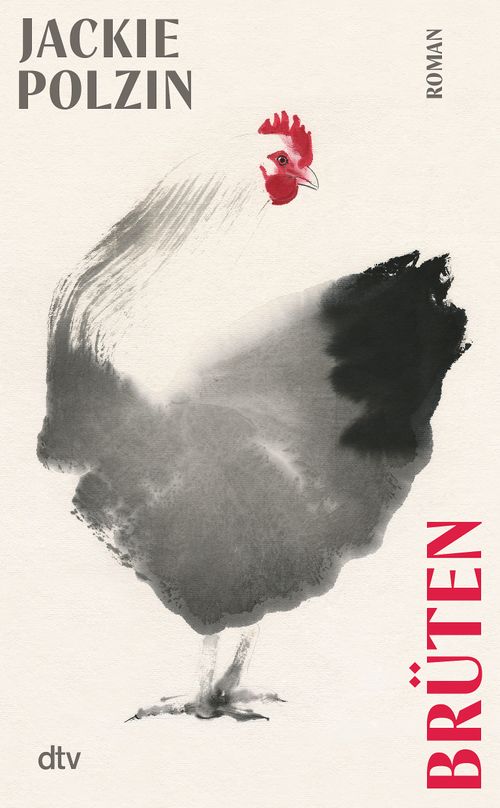Fünf Fragen an Jackie Polzin
Wie sie auf die Idee zu ihrem Roman ›Brüten‹ gekommen ist, welche Strategien ihr generell beim Schreibprozess helfen und was sie an Hühnern faszinierend findet, erzählt uns Jackie Polzin in einem kurzen Interview!
1. Gab es eine bestimmte Idee, aus der ›Brüten‹ entstanden ist? Können Sie uns allgemein etwas über Ihren Schreibprozess erzählen?
Nicht lange bevor ich anfing, das Buch zu schreiben, wurde eine unserer Hennen brütig und saß unermüdlich auf ihren Eiern. Wir hatten keinen Hahn, also gab es keine Möglichkeit, dass ein Küken aus einem der Eier schlüpfen würde. Jedes Mal, wenn ich ein Ei wegnahm, blieb sie dort stoisch sitzen. Ich hatte noch nie von einer brütigen Henne gehört, obwohl es ein verbreitetes Phänomen bei einigen Hühnerrassen ist. Zu der Zeit kämpfte ich selbst mit Unfruchtbarkeit und konnte nicht umhin, die Ähnlichkeiten zu bemerken – dass die Henne auf etwas wartete, was nie geschehen würde. Ich führe diesen Moment als Anfang meiner philosophischen Überlegungen zu Hühnern an, aber das entspricht nicht der ganzen Wahrheit. Zwölf Jahre zuvor hatte ich eine Kurzgeschichte in einem Schreibkurs am College über einen alten Mann verfasst, der in einer Fast-Food-Kette arbeitet und ein Huhn als Haustier hält. Wenn man die zentrale Frage von ›Brüten‹ als eine Version davon begreift, was es heißt, für etwas zu sorgen, glaube ich, war der erste Samen schon länger gesät. ›Brüten‹ zu schreiben war ein langsamer Prozess, aber ich verlor dabei nie das Gefühl von Dringlichkeit, das ich gegenüber dem Text verspürte.
Ich bemühe mich, jeden Tag zu schreiben und oft gelingt mir das. Wenn ich nicht schreibe, kritzele ich Notizen auf Papierfetzen (was wahrscheinlich auch als Schreiben zählt, nur ohne den Druck). Die Notizen sind meine Versuche, Reize festzuhalten, auf die ich später zurückgreifen kann. Manchmal funktioniert diese Strategie, die Notizen fangen einen Funken ein und helfen mir, beim Schreiben zu diesem Gefühl zurückzukehren, manchmal sind sie hingegen nutzlos. Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern; es ist auch möglich, dass die Notizen eine Form der Selbstlüge sind, eine Verleugnung der Zeitknappheit.
2. Was macht Hühner für Sie zu faszinierenden Tieren, über die es sich lohnt, zu schreiben? Und besitzen Sie selbst zurzeit Hühner?
Ich besaß Hühner, als ich anfing, das Buch zu schreiben. Ein Teil meiner Neugierde war auf die Verantwortung zurückzuführen, die ich damit übernommen hatte. Die Fragen danach, was ein Huhn braucht und was sein Verhalten mir sagen kann, stellten sich mir in meiner Rolle als Hühnerhalterin. Abgesehen davon, liebe ich den Spruch von Flaubert: »Alles wird interessant, wenn man es lang genug betrachtet.« Hühner werden schnell zu einem interessanten Untersuchungsgegenstand. Sie sind geschäftig und impulsiv und unbeholfen und nervös und haben ein feines Gespür für ihre Umgebung. Ein Huhn kann innerhalb einer Minute hocken, gackern, herumstolzieren. Es macht sogar Spaß, ihre zerstörerischen Tendenzen zu beobachten. Eigentlich ist es erstaunlich, dass ich mich jahrelang um Hühner gekümmert habe, ohne über sie zu schreiben. Momentan haben wir keine Hühner. Mein Mann und ich sind umgezogen, Eltern geworden und befinden uns in einer vorübergehend hühnerlosen Phase.
3. Die Erzählerin Ihres Romans bleibt namenlos. Gibt es einen Grund, warum Sie allen Figuren außer ihr einen Namen gegeben haben?
Ursprünglich hatte die Erzählerin keinen Namen, weil mir eine Tagebuchform vorschwebte, eine Art täglicher Bericht ihres Lebens. Nachdem ich viele Jahre lang an diesem introspektiven Aspekt gearbeitet hatte, gefiel mir der Effekt der Namenlosigkeit, die eine Entfremdung von der Welt suggeriert und die Einsamkeit der Erzählerin betont, oder sogar, wenn man dies noch weiterdenkt, der Erzählerin in gewisser Weise eines Vermächtnisses beraubt ist. Sie ist keine Außenseiterin, aber im Laufe der Geschichte bewegt sie sich mehr in die Welt hinein, zurück in ein Leben, das anders aussieht, als sie es sich erhofft hatte. Hühnern Namen zu geben, ist wiederum ein großes Vergnügen. Ich hatte nie daran gedacht, sie nicht zu benennen. Vielleicht, weil Hühner bereits im Nachteil sind, wenn es darum geht, als Individuen gesehen zu werden.
4. In ›Brüten‹ können die Leser*innen verfolgen, wie die Erzählerin mit den Nachwehen einer Fehlgeburt umgeht. Warum haben Sie dabei den Fokus auf das Alltägliche gelegt statt auf das traumatische Ereignis selbst?
Mein Erleben von Trauer fühlte sich an, als würde ich distanziert von meinem eigenen Leben existieren. Ich denke, diese Empfindung von Distanz geht auf eine veränderte Zeitwahrnehmung zurück, Trauer als ein Riss in der Zeit, und auf den Verlust von Genuss. Ich fragte mich, ob Essen wieder gut schmecken würde; wann ich mich wieder auf Dinge würde freuen können; was mich je wieder glücklich machen könnte. Trauer schluckt die kleinen Freuden. Und dennoch kann eine gewisse Präsenz oder Aufmerksamkeit im Alltag eine überraschende, kurzanhaltende Fröhlichkeit herbeizaubern. Ich wollte in meinem Roman die Möglichkeit der Transzendenz durch das Alltägliche zeigen. Daraus schöpfe ich große Hoffnung.
5. ›Brüten‹ lädt zu Vergleichen mit Autofiktion sowie Nature Writing ein. Wie würden Sie Ihren Roman kategorisieren?
Einige Elemente entspringen persönlichen Erfahrungen – ich hatte eine Fehlgeburt und Probleme mit Unfruchtbarkeit, ich habe Hühner großgezogen und in einem ähnlichen Haus gewohnt –, aber das Buch ist in erster Linie fiktional. Und ich freue mich über den Vergleich mit Nature Writing. Ich habe festgestellt, dass sich meine Aufmerksamkeit immer mehr auf die Natur richtet, auch wenn es sich um Natur im urbanen Raum handelt, wie es in ›Brüten‹ der Fall ist. Naturbelassene Gärten setzen sich allmählich in meiner Nachbarschaft durch und ich träume von einem einzigen großen Garten, der sich hinter ganzen Straßenzügen von Häusern erstreckt. Jemand sagte, das Buch erinnere ihn an ›Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten‹, nur mit Hühnern. Das gefällt mir, weil beide Bücher sich mit der transformativen Kraft von Hingabe auseinandersetzen.